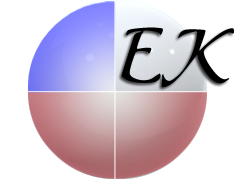(kunid) Würde man sie reduzieren, so wären mittel- und langfristige Veränderungen erforderlich, „die in mehreren Handlungsfeldern ansetzen“, wie es in einer Analyse des Wifo heißt.
Ein neues Papier aus dem Institut für Wirtschaftsforschungen (Wifo) setzt sich mit der Finanzierungsstruktur der Pensionsversicherung auseinander. Im Fokus steht das Spannungsfeld des Systems „zwischen Versicherung und Sozialpolitik“.
Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt zu etwa 73 % durch Beiträge der Erwerbstätigen, zu rund 27 % durch das Bundesbudget. Dies binde einerseits rund 13 % des Bundesbudgets, schreibt Autorin Christine Mayrhuber. „Diese Budgetmittel dienen andererseits der Abdeckung jener sozialpolitischen Funktionen, die dem Pensionssystem zugewiesen sind, wie u.a. der Absicherung vor Altersarmut, der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten oder der Versorgung von Hinterbliebenen.“
Leistungen über die klassische Versicherung hinaus
Mayrhuber stellt in dem insgesamt 12 Seiten langen Papier zunächst Struktur und Besonderheiten der Gesamtaufwendungen dar, anschließend die Beitragseinnahmenstruktur, gefolgt von einer Gegenüberstellung der Aufwendungen und Beitragseinnahmen.
„Maßnahmen wie Armutsreduktion, Rehabilitation, Hinterbliebenenversorgung und die Absicherung von Erwerbsunfähigkeit verfolgen primär sozialpolitische Zielsetzungen“, ist dort zu lesen.
Ihre Finanzierung über allgemeine Steuereinnahmen – also den Bundeszuschuss – gewährleiste eine „gesamtgesellschaftliche Beteiligung“ an der Bereitstellung dieser Leistungen, die über das klassische Versicherungsprinzip hinausgehe.
Wesentliche Rolle der Bundesmittel in der Finanzierung
Die Bundesmittel „waren und sind ein zentraler Bestandteil der Finanzierung der Pensionsversicherung“, heißt es dort. In Jahren mit rückläufiger Beschäftigung etwa habe die Ausfallshaftung des Bundes die Rückgänge der Beitragseinnahmen kompensiert.
„Auch führen strukturelle Verschiebungen zwischen Beschäftigtengruppen dazu, dass beispielsweise im landwirtschaftlichen Bereich einer aktiv versicherten Person durchschnittlich 1,2 Pensionen gegenüberstehen“, heißt es in der Analyse.
Angesichts dieses Ungleichgewichts erscheine eine Mitfinanzierung der Strukturverschiebung über allgemeine Steuermittel gesellschaftspolitisch grundsätzlich gerechtfertigt.
„Die Steuermittel in der Alterssicherung gleichen einerseits Strukturveränderungen aus und finanzieren andererseits gesellschaftspolitische Ziele und haben – gemeinsam mit der Ausfallshaftung – eine wichtige Stabilisierungsfunktion.“
Anstieg des BIP-Anteils der Bundesmittel prognostiziert
Im letzten Teil geht es um einen Blick in die Zukunft. „Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre, ihre hohe Erwerbsbeteiligung sowie der kontinuierliche Anstieg der Versicherungsjahre“, ist dort zu lesen, „führen in den kommenden Jahrzehnten zu einem Anstieg sowohl der Pensionsstände als auch der durchschnittlichen Pensionshöhen“.
Die Bundesmittel in der gesetzlichen Pensionsversicherung und im Beamtenbereich entsprechen laut dem Papier 6 % der Wirtschaftsleistung, wobei 3,5 Prozentpunkte auf die gesetzliche Pensionsversicherung und 2,5 Prozentpunkte auf Beamtete entfallen.
Dieser Anteil werde gemäß Projektionen der Alterssicherungskommission bis 2032 auf etwa 7,2 % steigen und bis 2070 bei rund 7 % verharren, „auch der Fiskalrat rechnet kurzfristig mit einem Anstieg und ab 2030 einer moderaten Entwicklung bis 2070“.
Bundesmittelreduktion bräuchte „mehrdimensionales Maßnahmenbündel“
Eine Reduktion der Bundesmittel würde mittel- und langfristige Veränderungen erfordern, „die in mehreren Handlungsfeldern ansetzen“. In dem Papier werden dazu mehrere Punkte aufgelistet.
Beispielsweise würde eine Verringerung der (Alters-)Arbeitslosigkeit kurz- und mittelfristig eine Finanzierungsverbesserung bewirken: Würde nur die Hälfte der über 50-jährigen Arbeitslosen ein Jahr lang zum Durchschnittslohn beschäftigt, so ergäben sich in der Arbeitslosenversicherung Minderausgaben von rund 570 Millionen Euro und in der Pensionsversicherung knapp 500 Millionen Euro an Mehreinnahmen.
Ein anderer Punkt: Auch nach Angleichung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters der Frauen ab 2034 bleibe das Pensionsantrittsalter eine „zentrale Steuerungsgröße“. Eine weitere Anhebung erfordere Rahmenbedingungen in Unternehmen, die Erwerbstätigkeit bis zum Regelpensionsalter und darüber hinaus ermöglichen und fördern.
Fazit: „Die Analyse macht deutlich, dass eine Reduktion der Bundesmittel im Alterssicherungssystem nur durch ein kohärentes, mehrdimensionales Maßnahmenbündel zu erreichen ist, dessen evidenzbasierte Ausgestaltung einer fundierten konzeptionellen Entwicklung und auch politischen Erörterung bedarf.“